Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
American Football als Pathosformel


Professor Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Gastprofessor für Literaturwissenschaften
- Zur PersonProfessor Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Der gebürtige Würzburger Professor Dr. Hans Ulrich Gumbrecht ist ständiger Gastprofessor für Literaturwissenschaften an die Zeppelin Universität. Er studierte Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, Salamanca, Pavia und Konstanz. Seit 1989 bekleidete er verschiedene Professuren für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Stanford University. Einem breiteren Publikum ist er bereits seit Ende der 1980er Jahre durch zahlreiche Beiträge im Feuilleton vor allem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung sowie durch seine Essays bekannt.
- Mehr ZU|DailyMüssen Sportler vorbildlich sein?Ob sie es wollen oder nicht: Sportler sind moralische Vorbilder. Und genau damit hoffnungslos überfordert. Was dürfen wir wirklich von ihnen erwarten? Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans Ulrich GumbrechtGewalt und Tod im SportIn den vergangenen zwei Jahrhunderten haben sich die Tabuisierung und das Verbot aller Arten von Gewalt zum westlichen Normalfall entwickelt. Ist es dann nicht an der Zeit, Sportarten wie das Boxen zu verbieten?Die Philosophie des leeren StadionsKein Ort der Begriffe und Argumente ist das Stadion. Wie kann es dann aber so faszinierend werden, wenn das Spiel vorbei ist und sich die Tribünen geleert haben? Gedanken am Rand, siebzig Minuten nach Abpfiff.
Vor nicht allzu vielen Jahren fanden es Intellektuelle noch witzig, ihre selbstverständliche Verachtung für den Fußball in die Frage zu fassen, „aus welchem Grund fünfundzwanzig erwachsene Männer hinter einem Ball herrennen sollten“. Mittlerweile profiliert sich der gebildete europäische Mittelstand – mit mehr oder weniger Sachkompetenz — in ausführlichen Fußballgesprächen, und dabei sind wohlmeinend moralische und nicht selten auch schicke ästhetische Urteile längst an die Stelle der alten politischen Verurteilungen getreten. Etwa gehört es derzeit in Deutschland zum guten Konversations-Ton, Spielern, Trainern und auch Club-Präsidenten ausgerechnet „Demut“ nahezulegen (oder sie für bewährte Demut zu loben), während spezifisch sportbezogene Begriffe der ästhetischen Wertschätzung noch auf sich warten lassen (bis auf weiteres nehmen ihren diskursiven Platz Wörter aus der jüngeren Trainersprache ein, wie die „Standards“ oder der „Sechser“).
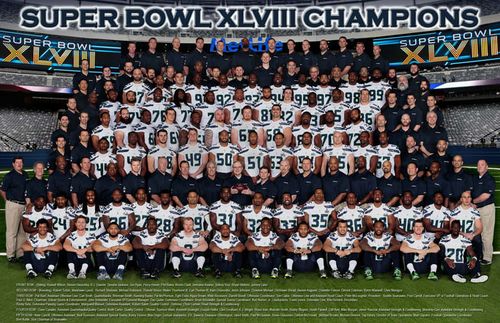
Niemand jedenfalls reagiert heute noch überrascht, wenn Fußball als ein Gegenstand ästhetischer Erfahrung genannt wird (nur die Frage, ob es sich um eine „niedere“, eine „ganz normale“ oder gar um eine „höhere“ Variante der ästhetischen Erfahrung handeln soll, scheint noch offen zu sein und wird entsprechend selten gestellt). Trotzdem sind herablassende Charakterisierungen des Sports nicht ganz verschwunden, sie nehmen nur einen neuen Ort in den Gesprächen und einen anderen Bezugspunkt ein. Wer Sportarten, die in Europa wenig populär sind, als groteske Veranstaltungen beschreibt – ob es nun um Baseball, Cricket oder Curling geht – hat noch immer die Lacher auf seiner Seite. Dabei sollte doch gerade ihn die Ironie der französischen Redeweise treffen, nach der „schlechter Geschmack stets der Geschmack der anderen ist.“
Ambivalent wirkt in dieser Hinsicht der Status des American Football. Einerseits ist mindestens das Endspiel der Profi-Liga in den Vereinigten Staaten, der sogenannte „Super Bowl“, längst zu einem weltweit notierten Medientermin geworden (er liegt dieses Jahr auf dem 1. Februar), andererseits geht den meisten internationalen Zuschauern offenbar noch jenes über die grundlegende Regelkenntnis hinausgehende Verständnis ab, das erst Begeisterung für einen Sport möglich macht (zumal wenn dessen Ereignisse einschließlich Werbeeinblendungen bis zu vier Stunden dauern). Oft habe ich in den vergangenen Jahren den Eindruck gehabt, dass für kleinlaute Enttäuschung oder höfliches Schweigen nach dem Superbowl-Sonntag ein Blick verantwortlich ist, der dem American Football – bei allem guten Willen – jede Abweichung vom Fußball übel nimmt. Vielleicht könnte ein Umdenken – oder genauer: ein Wechsel der Optik in mindestens drei Perspektiven — den Bann brechen und die schon bestehende diffuse Faszination für den American Football zu jener besonderen Intensität des Erlebens verdichten, die ihn (eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten) zum Lieblingssport der Vereinigten Staaten gemacht hat.
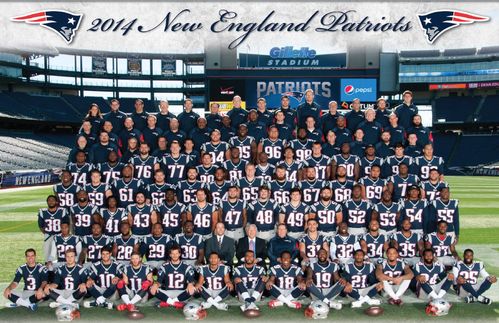
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, sich auf ein Spiel einzulassen, in dem Strategie von unbegrenzter Komplexität und freigesetzte Gewalt konvergieren. Beide Kraftfelder sind im American Football unverstellt und sehr explizit sichtbar. Man könnte deshalb sagen – aber das ist nur eine Bemerkung am Rand, die den American Football (oder den Sport generell) keinesfalls mit einer Aura versehen soll – dass hier in einem Höchstgrad an Intensität jene beiden Dimensionen greifbar werden (Strategie und Gewalt, Sinn und Sinnlichkeit), deren simultane Gegenwart seit dem siebzehnten Jahrhundert in den westlichen Kulturen „ästhetische Erfahrung“ ausmacht. Einerseits wird die Choreographie der Spielzüge jeder Mannschaft im Detail und langfristig (tatsächlich zu Beginn der Saison) festgelegt und vor ihrer Ausführung beständig in kurzen Gesprächen zwischen Spielern und Trainern situationsspezifisch justiert. Sie hat sogar ihr spezifisches Emblem auf dem Spielfeld, nämlich eine Manschette mit gedächtnisstützenden Informationen am Unterarm des Quarterbacks, jenes Spielers, der die offensiven Spielzüge einer Mannschaft koordiniert.
Ebenso explizit und unverstellt ist beim American Football andererseits die Gewalt im wörtlichen Sinn, das heißt Gewalt als körperliche Eroberung und Sperrung von Räumen gegen den Widerstand anderer Körper. Ähnlich wie beim Eishockey oder beim Boxen gibt es eine spezifische Form des Gewalt-Ereignisses, welches die Zuschauer besonders schätzen. Das ist der „clean hit“, jener Augenblick, wo die vorwärtsgerichtete Körperbewegung eines Spielers durch die genau plazierte Gegenbewegung eines anderen Spielers momentan und definitiv unterbrochen wird (zerren, nachgreifen, zweite Ansätze sind mit der Schönheit des „clean hit“ unvereinbar). Solange ein Zuschauer schon die bloße Möglichkeit, solche Szenen schön zu finden, bewusst oder vorbewusst ausblendet, weil er Gewalt und ästhetische Erfahrung für unvereinbar hält, bleibt ihm die besondere Attraktivität des American Football verschlossen. Deshalb auch irrt sich der südafrikanische Literatur-Nobelpreisträger und Rugby-Fan John Coetzee, wenn er prognostiziert, dass ein Verbot der Gewalt seinem Lieblingssport zu größerer internationaler Beliebtheit verhelfen könnte.

Immer wieder kommt es beim American Football zu Momenten, wo die Spannung zwischen komplexer Strategie und präsenter Gewalt einzelne Formen und Bilder von potentiell mythologischer Prägnanz hervorbringt. Zum Beispiel, wenn der Quarterback einen genauen Pass über dreißig oder vierzig Meter nur um den Bruchteil einer Sekunde vor dem Moment auf dem Weg bringt, wo ihn ein bulliger Abwehrspieler zu Boden reißt; oder wenn ein Spieler von mehreren Gegnern aggressiv verfolgt wird, weil er vorgibt, mit dem Ball im Arm Raum zu gewinnen, während ein anderer Spieler derselben Mannschaft den Ball tatsächlich – und völlig unbehindert — nach vorne bringt. In solchen Szenen verbinden sich die gegensätzlichen Kräfte von Strategie und Gewalt zu immer neuen Konfigurationen, die manchmal an jene Dynamik von (erhebender) Anmut und (erdgebundener) Schwere erinnern, die Heinrich von Kleists Essay über das „Marionettentheater“ beschreibt.
Doch solche Szenen der spannungsvollen Gegensätze können allein vor dem Hintergrund jener Grundbedingung des American Football aufscheinen, in der Strategie und Gewalt zur Synthese verbunden sind — da Strategien ja allein in der Dimension von Verkörperung wirklich werden. Dazu gehört auch die beständige, von jeweiligen Spiel-Situationen abhängige Ablösung unter den etwa sechzig hochspezialisierten Spielern jeder Mannschaft, die mit ihren Helmen, mit den von Schutzschienen geometrisch verbreiterten Schultern und unter Trikots mit riesigen Nummern stilisiert wie Schachfiguren aussehen. Dass jedenfalls Gewalt — und damit auch körperliche Bedrohung – immer im Spiel sind, erklärt zum einen, warum jede absichtliche Durchbrechung der Spielregeln (jedes „Foul“) im American Football unter strengsten Sanktionen steht (selbst den Spielern der eigenen Mannschaft vergibt ein Football-Fan Fouls nicht ohne weiteres). Zum anderen könnte diese Allgegenwart von Gewalt (und der mit ihr verbundenen Gefahren) auch der Grund für den singulären Grad an Leidenschaft unter Spielern und Zuschauern beim American Football sein. „Nach einer Niederlage“, hörte ich einmal einen erfolgreichen Running back sagen, „ist jedes Mal klar, dass man dieses Spielfeld nie hätte betreten sollen.“

Weniger unverstellt, mit weicheren Konturen und mit flexibleren Übergängen gehört der Grund-Kontrast zwischen Gewalt und Strategie freilich auch zu den meisten anderen Mannschaftssportarten, einschließlich des Fußballs. Durch eine ins Extrem getriebenes zweites Form-Prinzip aber, nämlich durch die Segmentierung des Spielflusses in eine Folge (vielleicht sollte man sagen: in ein Staccato) von oft nur wenige Sekunden dauernden Spielzügen, zwischen denen lange Auszeiten liegen, entwickelt der American Football einen besonderen Rhythmus. Dieser Rhythmus erklärt, wie aus sechzig Minuten reiner Spielzeit Sport-Ereignisse von dreieinhalb bis vier Stunden Dauer werden können, deren Intervalle bei Fernsehübertragungen – zur Frustration der internationalen Zuschauer — beinahe ausschließlich mit Werbung gefüllt sind. Warum aber fordert diese Struktur nicht auch die Geduld der amerikanischen Zuschauer (im Stadion und vor den Bildschirmen) bis zur Schmerzgrenze heraus?
Sie beschäftigen sich von „play“ zu „play“ (von „down“ zu „down“, wie man gleichbedeutend sagen kann) mit der immer neuen Frage, welche auch die Coaching Teams und die Spieler in Atem hält, nämlich welcher nächste Spielzug die andere Mannschaft überraschen kann — und damit zu Raumgewinn (für die Offensive / den Angriff) oder zur Blockierung von Räumen (für die Defensive / die Verteidigung) führen wird. Sobald sich ein Zuschauer auf diese Art der „mitdenkenden“ Teilnahme einlässt, behaupte ich, hat ihn die Faszination des American Football erreicht. Auf dem Spielfeld selbst geht es aber nicht allein um das strategische Vorausdenken, sondern „down für down“ auch um jeweilige Teil-Wettbewerbe, die oft einen individuellen Akzent haben. Für Minuten gespannter Erwartung und dann wenige Sekunden von komplexer Bewegung und Gewalt geht es immer wieder allein um die Frage, ob die Mannschaft im Ballbesitz oder die ohne Ball verteidigende Mannschaft das nächste „play“ gewinnt, das sich seinerseits aus einer Serie von Zweikämpfen zusammensetzt. Oft feiern die Sieger entscheidender Zweikämpfe innerhalb eines Spielzugs den Erfolg mit soviel Emphase, als hätten sie eben den Superbowl gewonnen.

So laden sich die nur scheinbar langweiligen Intervalle der Spiels im American Football zu Phasen wachsender Spannung und ihrer Entladung auf. Dass eine Mannschaft nur dann im Ballbesitz bleiben darf, wenn sie in einer Folge von höchsten vier „downs“ den Ball um – zusammengesetzte – zehn Yards weiterbewegt, steigert eben diese Spannung nach der Form eines Crescendo. Die lautesten Stadionmomente sind im Normalfall die Sekunden von Anspannung vor einem dritten „down“, nach dem die Mannschaft der Offensive, wenn sie den Ball nicht um insgesamt zehn Yards weiterbewegt hat, die offensive Kollektivrolle ihrem Gegner überlassen muss. Ganz entgegen dem Eindruck eines Blicks von außen, der in der Segmentierung der Spielzüge nur Langeweile sehen kann, liegt gerade in dieser — wiederum sehr harten — raumzeitlichen Stückelung ein für die Zuschauerpartizipation ausschlagebender (und recht rigider) Rahmen. Erst in ihm können sich Szenen von Gewalt und Strategie wirklich entfalten.
Die Abfolge von Spielzügen als Mini-Wettbewerben vollzieht sich beim American Football oft als eine Erschöpfungsschlacht, die mit dem Kollaps der einen Abwehr endet, wenn sie ihren Raum nicht mehr gegen die Körper der anderen Mannschaft geschlossen zu halten vermag. Zugleich, drittens — und im genau entgegensetzten Rhythmus – ist der American Football auch ein Spiel der unwahrscheinlichen, aber immer möglichen dramatischen Wendungen (fast möchte man sagen: ein Spiel des immer wieder plötzlich umschlagenden Schicksals). Wie bei allen Sportarten, die es erlauben, den Ball mit den Händen zu schützen und zu führen, ist die Ballsicherheit beim American Footballs sehr hoch – und gerade deshalb werden Momente des plötzlichen Umschlagens der Spielrichtung (oder des Schicksals) als besonders einschneidend erlebt.

Etwa, wenn es einem Abwehrspieler gelingt, den Ball aus der Armen eines Angriffsspielers zu schlagen, ihn aufzufangen und dann in Gegenrichtung eine perplexe Aufstellung aus Offensivspielern zu überrennen, die sich auf ihre plötzlich eingetretene funktionelle Abwehrrolle noch nicht eingestellt haben. Einen ähnlichen Effekt bringt die sogenannte „Interception“ hervor, das heißt jener Moment, in dem ein Defensivspieler den Pass eines Quarterbacks abfängt und damit in Ballbesitz kommt. Dazu gehört auch ein Bündel von Regeln, die es im Spielstand zurückliegenden Mannschaften – bei hohem Risiko eines sich dann definitiv gegen sie kehrenden „Schicksalsumschlags“ – ermöglichen, innerhalb weniger Sekunden den Spielstand mehrfach und oft sogar entscheidend zu verbessern. Mit anderen Worten: selten (und im Verlauf eines Spieles nur sehr spät) kann die Differenz der von beiden Mannschaften erzielten Punkte so deutlich sein, dass Sieg und Niederlage unumkehrbar feststehen. Die Spannung schwindet wirklich zuletzt beim American Football.
Jene drei Phänomenbereiche, die Verfugungen aus Strategie und Gewalt, das Staccato und Crescendo der Spielzüge, zusammen mit der Tendenz zu Kipp-Momenten und dramatischen Wendepunkten, machen in ihrer Konvergenz die besondere Form und zugleich die besondere Zuschauer-Faszination des American Football aus. Aus der Wirkung ihres Zusammenspiels ergibt sich eine eigentümliche Affinität zum Begriff der „Pathosformel“, dessen Kurswert in der gegenwärtigen Kunstwissenschaft und Kunstkritik so hoch ist. Denn aus der Konvergenz und Akkumulation der beschriebenen drei Bereiche entsteht im American Football ein Spiel der harten, dramatisch anmutenden, sich wie notwendig und geradezu archaisch oder elementar zeigenden Formen — die dann im choreographischen Zusammenhang zu prägnanten Formeln und Gesten werden. Auf der Grundlage allgegenwärtiger Gewalt sind diese Formeln und Gesten nicht nur verkörpert, sondern auch in einem hohen Intensität-Grad affektiv aufgeladen, bis hin zum Pathos eben, zur verkörperten Leidenschaft.

Dabei stellen die Pathosformeln des American Football nichts dar, sie sind keine Allegorien, die Platz für Bedeutungen halten und sie zugleich artikulierten. Eher wirken sie wie zu Pathos und Intensität komprimiertes Leben. Und in der Tat verfolgen die leidenschaftlichen Anhänger dieses Sports ihre Lieblingsspieler über außergewöhnlich lange Strecken des Lebens. Zuerst über die vier Jahre, wo Football als College-Sport gespielt werden kann, der übrigens insgesamt mehr Zuschauer anzieht als die so perfekt gemanagte Profi-Liga — und dann, in einigen wenigen Fällen zumindest, über die Schwelle zwischen College und Profiliga hinweg innerhalb einer Profikarriere, wo die individuellen Einkünfte denen der berühmtesten Fußball-Ligen ähneln.
Doch so wie die Raum- und Zeit-Rahmen des American Football mit Strategien durchwirkte Gewalt zu Pathosformeln komprimieren, können diese Pathosformeln ihre Resonanz vielleicht nur innerhalb der Kultur der Vereinigten Staaten als einem spezifischem Kontext finden. In einer Kultur harter Konturen und oft unverstellt intensiver Affekte.
Der Artikel ist im FAZ-Blog „Digital/Pausen“ von Hans Ulrich Gumbrecht erschienen.
Titelbild: Anthony Quintano (Flickr: Super Bowl XLVIII (48) New
York New Jersey) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Bilder im Text: Seattle Seahawks (Download Bereich)
New York Patriots (Dowload-Bereich)
Mike Mozart / flickr.com (CC BY 2.0)
Philip Robertson / flickr.com (CC BY 2.0)
SAB0TEUR / flickr.com (CC BY-SA 2.0)
Pete Souza [Public domain], via Wikimedia Commons
Ken Lund / flickr.com (CC BY-SA 2.0)
Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Redaktionelle Bearbeitung: Florian Gehm und Alina Zimmermann



