Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Einfach komplex


Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Gastprofessur für Literaturwissenschaften
- Zur PersonProf. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Der gebürtige Würzburger Professor Dr. Hans Ulrich Gumbrecht ist ständiger Gastprofessor für Literaturwissenschaften an die Zeppelin Universität. Er studierte Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, Salamanca, Pavia und Konstanz. Seit 1989 bekleidete er verschiedene Professuren für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften der Stanford University. Einem breiteren Publikum ist er bereits seit Ende der 1980er-Jahre durch zahlreiche Beiträge im Feuilleton vor allem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung sowie durch seine Essays bekannt. Darin befasst er sich immer wieder auch mit der Rolle des Sports. Gumbrecht ist bekennender Fußballfan und Anhänger von Borussia Dortmund.
- Mehr ZU|DailyEin grenzenloser Freiheitskampf?Wo bleibt in Zeiten von Algorithmen und Big Data die Freiheit? In Kunst und Wissenschaft? Und wenn ja, welche Optionen für Freiheit bieten sie an? Mit diesen und weiteren Fragen befasst sich die zehnteilige öffentliche Ringvorlesung „Inseln der Freiheit“.Neu konfigurieren bitte!Populismus, autoritäre Regime, Nationalismus. Es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie Freiheit auch im 21. Jahrhundert verstanden und geschützt werden kann. Genau das tut Professor em. Dr. Helmut Willke in seinem aktuellen Buch.Wollen wir noch echte "Freiheit"?"Freiheit", der strahlende Wertbegriff aller bürgerlichen Revolutionen, ist heruntergekommen zu einem beliebigen Element von Gruß- oder Glückwunsch-Adressen. Haben wir denn noch einen Freiheits-Bedarf? Ein Kommentar von Prof. Dr. Hans Ulricht Gumbrecht.
Obwohl Hollywood seit dem frühen, Nobelpreisträger aus Berkeley wie Stanford seit dem mittleren und Silicon Valley seit dem späten 20. Jahrhundert mit immer neuen Energieschüben die Welt entscheidend belebt haben, traut die westliche Kultur intellektuellen oder gar politischen Impulsen von ihrem pazifischen Ende herzlich wenig zu. Die Intuition etwa, dass sich dort eine neue Praxis von Freiheit zeigen und einspielen könnte, löst unter eisernem Widerstand gegen den gerne heraufbeschworenen – und anscheinend nie einer Definition bedürfenden – „Neoliberalismus“ an der amerikanischen Ostküste ein ebenso lässiges Abwinken aus wie in Europa.
Für diesen nie revidierten Reaktionsmechanismus lässt sich die Geschichte des im Sommer 1989 erschienenen und bis heute sprichwörtlich berüchtigten Essays von Francis Fukuyama unter dem Titel „The End of History?“ als klassischer Fall anführen. Die von dem damals noch unbekannten Autor nicht vorhergesehene Implosion des Staatssozialismus in gerade jenem Jahr hatte dem Thema eine massive internationale Resonanz beschert, deren empörteste Stimmen heftig gestikulierend die vermeintlichen – aber von Fukuyama keineswegs vertretenen – „Thesen“ zurückwiesen, die Welt werde sich nun nicht mehr verändern oder die Vergangenheit habe jede Bedeutung für Gegenwart und Zukunft verloren. Tatsächlich hatte er mit dem Wort „History“ auf das seit dem frühen 19. Jahrhundert etablierte geschichtliche Weltbild angespielt und auf dessen Versprechen eines staatlich beförderten Fortschritts hin zur Freiheit als gesellschaftlicher Selbstbestimmung.
Dass eben jener Prozess an sein eher erfolgreiches Ende und mithin zu seiner Selbstaufhebung gelangt war, konstatierten seit Mitte der 90er-Jahre dann auch viele jener Beobachter, die Fukuyama nicht hatten ernst nehmen (oder bewusst missverstehen) wollen. Die neue Form von Zeit, in der wir seither global (das heißt: elektronisch vernetzt) unseren Alltag leben, kann man als „breite Gegenwart“ beschreiben. Anders als im historischen Weltbild präsentiert sich ihre Zukunft nicht mehr als ein zu gestaltender Horizont von Möglichkeiten, sondern als Zone von Gefahren, die unvermeidlich auf die Menschheit zuzukommen scheinen (Klimawandel, demografische Entwicklung oder Erschöpfung der Energiequellen); statt immer weiter hinter uns zu bleiben und damit zunehmend an Relevanz zu verlieren, überflutet die Vergangenheit nicht zuletzt aufgrund elektronischer Speichermöglichkeiten die Gegenwart (kein Tag im Kalender, der kein „historischer Gedenktag“ wäre); und zwischen der blockierten Zukunft und der geradezu aggressiv präsenten Vergangenheit ist aus der nicht wahrnehmbar kurzen Gegenwart des Übergangs im historischen Weltbild eine unbewegt breite Gegenwart der Simultanitäten geworden. Alles, Zukunft wie Vergangenheit, wird als Teil der Gegenwart erfahren. Allerdings entspricht es der Logik dieser Zeitlichkeit ohne Vergessen, dass auch das historische Weltbild, statt „überwunden“ zu sein, als Teil der neuen breiten Gegenwart verfügbar bleibt.
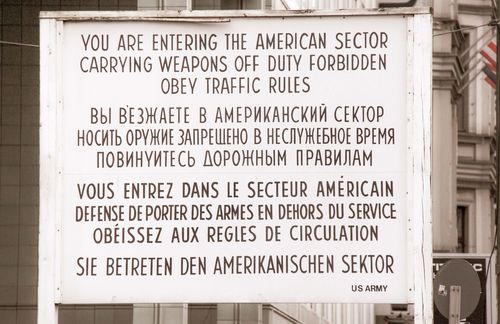
Aus der zu erobernden und zu gestaltenden Freiheit des historischen Weltbilds ist während des vergangenen Vierteljahrhunderts in dem Maß eine wachsende Überlast von Komplexität geworden, wie sich die zur Wahl stehenden Lebensformen und Handlungsmöglichkeiten für die Mehrheit der Weltbevölkerung vervielfacht haben, ohne dass neue, verbindliche Formen ihrer Bearbeitung und Reduktion zur Verfügung stehen. Diese Last der allgegenwärtigen Freiheitskomplexität, meine ich, erklärt das ebenfalls allgegenwärtige Aufkommen neuer politischer Fundamentalismen. Sie sind Antworten auf eine existenzielle Sehnsucht, sich in Situationen individueller Überkomplexität an „starken“ Persönlichkeiten und ihren unterkomplexen Positionen festzuhalten.
Doch damit ist nur der eine, sichtbarere von zwei Typen des gegenwärtigen Fundamentalismus benannt. Ihm funktionsäquivalent, wenn auch ideologisch entgegengesetzt, hat sich – keinesfalls nur in den Vereinigten Staaten und an ihren Universitäten – die ursprünglich selbst ernannte „politische Korrektheit“ entwickelt, die das ja nie ganz eliminierte historische Weltbild mit seinen Patina-überzogenen Zukunftsversprechen, „ethischen“ Gewissheiten und staatlich garantierten Freiheiten von vielfältiger Unterdrückung wieder in Umlauf gebracht hat, so als seien wir nie am „Ende der Geschichte“ angekommen. Freiheit als individuelle Überlast in der breiten Gegenwart, müssen wir konstatieren, ist zu der zynisch praktizierten „Freiheit“ von Politikern der lauten Töne und von selbst ernannten Vordenkern mutiert, allerlei Varianten komplexitätsreduzierender Orientierungen und Sicherheiten ganz ohne Argumente anzubieten.
Die Welt um die Bay von San Francisco jedoch, welche das Silicon Valley einschließt, ohne mit elektronischer Technologie synonym zu sein (so empfinden es selbst Besucher aus Europa, um dann schnell über die eigene Begeisterung erschrocken zu sein), lebt in täglicher Intensität eine andere Form von Freiheit, die sich weder als Alternative oder gar als globale Problemlösung auffasst noch an die hoch kanonisierten Freiheitswerte der Gründerväter amerikanischer Demokratie anschließt. Viele reiben sich die Augen angesichts solcher Erfahrungen: Denn wie soll sich eine neue Praxis von Freiheit innerhalb jener Gesellschaft ereignen, die Donald Trump zu ihrem Präsidenten gewählt hat (und möglicherweise wiederwählen wird), zumal in einem Landstrich, der Milliardäre nach Tausenden zählt?
Die erste, sachlich-einfache Antwort heißt, dass Nordkalifornien entgegen der altehrwürdigen Gleichung „reich = rechts“ zu den wenigen verbleibenden Hochburgen des liberalen Flügels der demokratischen Partei gehört. Weiter trägt und möglicherweise zu den Prämissen der anderen Freiheit gehört eine Tendenz, die hier „libertarian“, „libertär“, heißt und die sich möglicherweise verstärkt hat, seit ihre eher paradoxalen Versuche einer Parteigründung glücklicherweise im Sand verlaufen sind. In nicht zu unterschätzender amerikanischer Tradition respektiert man die Gesetze des Staates, erfüllt (anders als der Präsident) seine gar nicht so niedrigen Steuerauflagen – und nutzt Freiheit als individuelle Unabhängigkeit, die vom Staat (mit Ausnahme der Freiheit zur Meinungsäußerung) weder geschützt wird noch gegen ihn zu erringen ist. Washington scheint an die Peripherie gerückt. Von Donald Trump ist in europäischen Medien mehr die besessene Rede als bei Gesprächen unter Kaliforniern.
Entscheidungen werden zweitens – selbst auf der Ebene von Unternehmen – wenig prinzipienorientiert und kaum im Blick auf langfristige Entwicklungen vollzogen. Es geht um den jeweils nächsten Schritt, das nächste Wochenende, die nächste Bilanz – jedenfalls im Vollzug des Alltags, während sich allein die international bekannten Protagonisten von Silicon Valley zunehmend in einem Anspruch und Diskurs grundsätzlicher Menschheitsbeglückung gefallen. Nachdem sie sich bei einer Podiumsdiskussion mit Akademikern über den Mangel an qualifizierten jungen Fachkräften beklagt hatte, sah sich eine einflussreiche Vertreterin von Google mit dem Vorschlag konfrontiert, für einige Jahre die Einstellung einer bescheidenen Zahl von Studenten mit Stanford-Diplom zu garantieren. Ihre kurz angebundene ablehnende Antwort verwies auf ständig fluktuierende Konjunkturlagen und individuelle Kompetenzprofile als einzig relevante Kriterien der Personalpolitik.
Im aktuellen Produktionsprozess, dies gehört zu den am häufigsten wiederholten Beobachtungen über Silicon Valley, bleiben die Hierarchien innerhalb der erstaunlich kleinen Arbeitsgruppen flach und flexibel. Dies setzt Gleichheit als eine dritte Komponente der Freiheitspraxis voraus. Nicht allerdings Gleichheit als vom Staat auferlegte Grenze individuell erfolgreicher Entfaltung, sondern als beständig erneuerte Gleichheit der Chancen und Startbedingungen. Zur Typologie der weltweit kopierten Start-ups gehört auch die Freiheit, einen Ansatz, dessen Versprechen und Prognosen sich nicht erfüllen, früh abzubrechen, ohne dass ein solcher Schritt unmittelbar die Möglichkeit eines neuen, anders orientierten Versuchs beeinträchtigte.

Als Fluchtpunkt aus individueller Unabhängigkeit, kurzfristiger Planung und erneuerbarer Gleichheit der Startbedingungen mag dann das ganz konkret verstandene Leitmotiv von Nordkalifornien entstanden sein: „Nothing is impossible.“ Vom klassischen Selbstverständnis der Vereinigten Staaten als „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ unterscheidet es sich durch seine Offenheit für das nicht Vorhergesehene und Vorhersehbare, für das Ereignis und für die überraschende Herausforderung, aus deren Bewältigung sich Diskontinuitäten mit Innovationswert ergeben können. Eine Euphorie der Nüchternheit (wie sie Friedrich Hölderlin vielleicht beschrieben hätte) klingt in diesem Satz an, ein unbegrenztes Selbstvertrauen mit Augenmaß und ein ekstatischer Realismus, die zum Beispiel das Gefühl vieler Programmierer erklären, allein in Silicon Valley ihre stärksten Intuitionen zu haben. Sie nennen diese Stimmung „bliss“, im Sinn eines (nie auf Dauer gestellten) Glücks, ja eines säkularen Segens, die wie objektive Arbeitsbedingungen wirken und sich dennoch stets individuell artikulieren.
Habe ich mich nun zu der kaum zu verantworteten Behauptung verstiegen, meine Wahlheimat sei eine Insel der Seligen? Oder anders formuliert: Was ist der Preis von „bliss“, soll und kann man diese Gegend wirklich nachahmen? Eine Dimension jenes Preises liegt in der beständigen Anspannung eines Wettbewerbs, der sich aus heroischer Subjektperspektive als athletisch und in sozialdemokratischer Interpretation als Stress erleben lässt. Zu ihm gehört – bei aller erneuerbaren Gleichheit der Startchancen – das Risiko eines Scheiterns, das nicht durch wohlfahrtsstaatliche Sicherheitsnetze aufgefangen wird. Und solches Scheitern ist auch die eine Seite einer potenziell grenzenlosen Ungleichheit, die gerade im Umfeld der Konzern-Headquarters, aber selbst nahe beim Stanford-Campus greifbar wird.
Die Seligkeit der – neuen – Freiheit bleibt wohl nicht nur lokal eine Seligkeit auf Zeit und mit kaum ausschaltbaren Risiken. Ob wirkliche individuelle Freiheit ohne solche Komponenten zu haben und zu erleben ist, bleibt eine Frage für die Zukunft. Ich kann mir eine andere Existenz (auch und durchaus im Sinn einer Sucht) nicht mehr vorstellen, weil sie – selbst im achten Lebensjahrzehnt – die Möglichkeit von einer nie vorwegzunehmenden Selbsterneuerung einschließt. Dies scheint dem zwei Jahre weniger alten Francis Fukuyama ähnlich zu gehen, der 2010 von der Johns Hopkins University in Baltimore nach Stanford gekommen ist. Hatte sein frühes Verständnis vom „Ende der Geschichte“ zu einer Unterstützung explizit neoliberaler Positionen geführt, so gehört er heute zu den schärfsten und kompetentesten Kritikern von Donald Trump. Was ihn allerdings kaum auf eine stabile politische Position festlegen wird.
Dieser Beitrag ist am 9. November unter dem Titel „Nichts ist unmöglich: Über die Freiheit am westlichen Ende der Welt“ in der WELT erschienen.
Titelbild:
| Junior Moran / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Bilder im Text:
| Tanja Cotoaga / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
| Isai Ramos / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm



