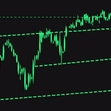Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Global, regional, ganz egal?


Professor Dr. Heribert Dieter
- Zur PersonProfessor Dr. Heribert Dieter
Heribert Dieter wurde geboren 1961 und forscht zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Er lehrt seit dem Fall Semester 2009 an der Zeppelin Universität. Dieter studierte von 1983 bis 1989 Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der FU Berlin, wo er 2005 auch seine Habilitation ablegte. Zu seinen aktuellen Forschungsvorhaben zählen die Untersuchung von Reformoptionen für die internationalen Finanzmärkte, die Analyse der Perspektiven der Europäischen Währungsunion und monetärer Kooperation in Asien sowie die Betrachtung der Position Deutschlands in der Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts.
- FactboxDie BaFin: Regulierung in der Bundesrepublik
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz BaFin – vereinigt die Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapierhandel unter einem Dach. Sie ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts und unterliegt der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Sie finanziert sich aus Gebühren und Umlagen der beaufsichtigten Institute und Unternehmen. Die BaFin ist im öffentlichen Interesse tätig. Ihr Hauptziel ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten. Die rund 2.365 Beschäftigten der BaFin arbeiten in Bonn und Frankfurt am Main. Sie beaufsichtigen 1.854 Banken, 681 Finanzdienstleistungsinstitute, etwa 592 Versicherungsunternehmen und 30 Pensionsfonds, sowie 6.069 inländische Fonds und 78 Kapitalanlagegesellschaften.
- Mehr ZU|DailyMarktakteure brauchen DompteureAus Eigennutz sollten es auf dem Finanzmarkt klarere Regeln geben, sagt ZU-Professor Dr. Helmut Willke. Denn nationale Interessen seien in einer globalisierten Welt nur mit Rücksicht auf globale Kollektivgüter nachhaltig zu verwirklichen. Willkes neues Buch „Political Governance of Capitalism“ liefert Ansätze dafür, wer konkret dem Spiel der globalen Finanzindustrie Einhalt gebieten könnte.Weniger Komplexität ist mehrDas globale Finanzsystem ist mit einem systemischen Risiko behaftet. Professor Dr. Helmut Willke widmet sich in seinem aktuellen Forschungsprojekt der Entstehung dieser Risiken aus unorganisierter Komplexität.Quo vadis, Nationalstaat?Parteien, Unternehmen und vor allem auch die Wissenschaft: ZU-Professor Dr. Helmut Willke und Dr. Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik debattierten in diesem Kontext beim Veranstaltungsformat „RedeGegenRede" am Hauptstadtcampus der Zeppelin Universität kontroverse Ansätze.
Ganz so einfach ist das Wirtschaftssystem wohl doch nicht. Denn auch wenn die breite Masse gerne pauschalisiert, sei es der falsche Schritt, die Weltwirtschaft in einen Topf zu stecken, erklärt Dieter bei seiner Antrittsvorlesung an der Zeppelin Universität. Zunächst einmal müsse schließlich zwischen dem reinen Güter- und Warenmarkt und den so oft kritisierten Finanzmärkten unterschieden werden. Genau diese beiden Sektoren haben sich in den letzten Jahren deutlich von einander getrennt und müssen daher auch bei möglichen Regulierungen separat bedacht werden. Warum teilweise sogar regionale Spielregeln effektiver sein könnten, ist nur eine der Fragen, mit denen sich Dieter im Rahmen seiner Gastprofessur beschäftigen wird.
Aber wer das heutige Wirtschaftssystem verstehen will, der müsse zuerst zurückblicken, holt Dieter aus. 2001 kommen die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. Die Debatten verlaufen zäh; erst 2005 zeichnen sich die ersten Ergebnisse ab. „Sie müssen sich vor Augen führen, dass die Zeit damals eine völlig andere war“, erklärt er. „Das Bruttoinlandsprodukt von Russland war damals so klein wie das von Belgien, China war gerade der WTO beigetreten und Brasilien hatte eine schwere Finanzkrise hinter sich gebracht.“
In genau dieser Zeit machte der damalige Generaldirektor Mike Moore einen für Dieter schweren Fehler und taufte die Zusammenkunft der Mitglieder vorschnell „Development Round“. Sofort meldeten sich daraufhin die Entwicklungsländer mit massiven Forderungen zu Wort und die etablierten Industrienationen wandten sich ähnlicher Bestimmtheit von den Verhandlungen ab. „Die Runde war gescheitert“, konstatiert Dieter. „Statt einer multilateralen Handelsordnung wurden insgesamt 300 neue Freihandelszonen geschaffen.“ Was zunächst nach einer förderlichen Maßnahme klingt, sei aber zugleich das größte Problem der Runde gewesen, führt Dieter aus. Solche sogenannten Präferenzhandelsabkommen waren damals nur für kleine Staaten gedacht. Die Anwendung auf hunderte Handelsbeziehungen hält Dieter im Rückblick gar für gefährlich. Denn „die Abkommen ersetzen die gemeinsamen Regeln der WTO“, erklärt er.

In Fachkreisen tummeln sich zwei wesentliche Theorien über das Scheitern dieser Verhandlungen. Zum einen könne eine Hegemonialmacht fehlen, die Spielregeln klar definiert und durchsetzt, beschreibt Dieter. Als zweite Ursache käme der Trugschluss hinzu, dass die wachsende Abhängigkeit zwischen Staaten zwangsläufig zu einer besseren Kooperation führt.
„In gewisser Weise werden die Staaten durch die Globalisierung sogar handlungsunfähig“, entgegnet Dieter und nennt die „Denationalisierung“ als wesentlichen Grund für diese Beobachtung. Und so bleibt eine multilaterale Zusammenarbeit auch im Jahr 2013 die Ausnahme. „Einige Kollegen sprechen sogar schon davon, dass heute jeder Staat für sich kämpft“, bemängelt Dieter. Und so sei es wenig verwunderlich, dass in den OECD-Staaten die Abneigung gegen die Globalisierung wächst. „Sogar in Deutschland sieht die Mehrheit mehr Risiken als Chancen für das eigene Land in der Globalisierung“, bemängelt Dieter. Und da für gemeinsame Entscheidungen die politische Rückendeckung fehle, stolpere die Weltwirtschaft „in jede Menge Präferenzabkommen und ist von Diskriminierung geprägt“, schließt Dieter seine Ausführungen. Und wer genau hinsieht, der werde sogar an die 1930er Jahre und ihre dramatischen Folgen erinnert, warnt er.
Während sich Dieter im Waren- und Güterhandel nach mehr globalen Spielregeln sehnt, übernimmt die Gruppe der G20 diese Forderung für die internationalen Finanzmärkte. Von Beginn an hält Dieter allerdings gegen diese Position: „Ich plädiere für Diversität in der Regulierung und nicht für einheitliche Regeln“, beschreibt er seinen Standpunkt. Schließlich sei es fraglich, ob man mit globalen Regeln zukünftige Finanzkrisen überhaupt verhindern könne. „Nein“, lautet seine Antwort, denn stattdessen sollten sich Regeln lieber von Region zu Region unterscheiden. Ein ganz einfaches Beispiel sei hier die Abkehr vom „Heimatlandprinzip“ hin zum „Gastlandprinzip“ bei der Bankenregulierung. Was kompliziert klingt, sei denkbar einfach, erläutert Dieter: „Banken müssen in Zukunft dort reguliert werden, wo sie tätig sind. Wo sie ansässig sind, das spielt keine Rolle.“

Statt irgendeine Form der Regulierung zu schaffen, haben zu viele Staaten in den letzten Jahren aber nach nachsichtigen Regeln gestrebt, kritisiert Dieter. Sogar in Deutschland wurde die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) immer wieder zurückgepfiffen, wenn sie stärkere Regulierungen gefordert hat, heißt es unter der Hand. „Dass sich Finanzkrisen verhindern lassen, ist absurd zu denken“, sagt Dieter. Aber mit diversen Regeln ließen sich auch komplexe Systeme stabilisieren. „Und genau deswegen brauchen wie regionale Regeln für die Finanzmärkte.“ So könne dann am Ende die nationale Politik entscheiden, ob der Verlust einiger Banken, die ins Ausland abwandern, schwerer wiege, als das Risiko einer neuen Finanzkrise.
Beispielsweise die Schweiz setzt genau dieses Konzept bereits heute um. Mit der UBS sei eine der großen Schweizer Banken kurz vor dem Zusammenbruch gewesen, beschriebt Dieter. „Deswegen hat sich die Schweiz entschlossen, ihren großen Banken sechs Prozent mehr Eigenkapitalanteil abzufordern – und das haben sie im Alleingang durchgezogen.“ Auch die Vereinigten Staaten hätten mit der Umsetzung des Gastlandprinzips bereits einen ersten Schritt gewagt, bestätigt Dieter. Ein völlig verständlicher Schritt, denn im Gegensatz zur Handelspolitik gehe es am Ende des Tages um die Haftung, erläutert Dieter: „Die Staaten haften für ihre Banken, haben aber keinen hinreichende Einfluss auf globale Regeln“, beendet er sein Plädoyer für regionale Einflussnahme. Und auch wenn nach den letzten Krisen viele eine globale Aufsicht fordern: Von weltweiten Regeln müsse man sich in der Finanzwelt verabschieden.
Titelbild: Ivan McClellan (CC BY 2.0)
Text: riko.jennrich (CC BY-NC 2.0) | Travel Aficionado (CC BY-NC 2.0)