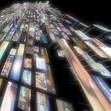Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Resolut, rational, responsiv


Professor Dr. Dirk Heckmann
- Zur PersonProfessor Dr. Dirk Heckmann
Professor Dr. Dirk Heckmann ist Leiter des Zentrums für Recht, Sicherheit und Vertrauen in elektronische Prozesse am „Deutsche Telekom Institute for Connected Cities | TICC“ der Zeppelin Universität. Zudem ist er Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sicherheits- und Internetrecht an der Universität Passau. Als ausgewiesener Experte in Fragen des IT-Rechts ist er außerdem in verschiedenen Gremien tätig.
- FactboxAUF
Dieser Artikel ist in AUF, dem Magazin für Zwischenfragen der Zeppelin Universität, in Papierversion zu lesen.
#03 beschäftigt sich mit "Bürger. Macht. Staat?"Zwischenfrage an Dirk HeckmannStimmen und Stimmungen werden im Web 2.0 inzwischen nicht nur von partizipationswilligen Bürgern eingebracht, sondern längst gezielt von Lobbyisten und PR-Agenturen, und dies gern auch verdeckt. Wie verträgt sich dies mit Ihrer These der neuen responsiven Demokratie?
„Verdeckter Lobbyismus ist auch in der responsiven Demokratie nicht zu verhindern. Er wird aber schneller entlarvt. Außerdem sieht er sich kritischen Fragen und kontroversen Diskussionen ausgesetzt. Das schmälert seinen Einfluss.“Zwischenfrage an Dirk HeckmannInwieweit üben Sie selbst politische Partizipation über das Web 2.0 aus?
„Ich gehöre wohl zu den eher seltenen Wissenschaftlern, die sowohl einen eigenen Blog (www.for-net.info/) und einen Twitteraccount (@elawprof) als auch Facebook-Fanseiten und einen Youtube-Channel besitzen und intensiv für Information, Kommunikation und Interaktion nutzen. Als sachverständiges Mitglied des CSU-Netzrates, aber auch als Leiter der Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik habe ich so die Chance, mit meinen politischen Ideen auf breite Resonanz zu stoßen.“ - Mehr ZU|DailyNeue Medien verstehen lernenDas Mohammed-Schmähvideo mit seinen Folgen ist ein Phänomen der mediatisierten Moderne. Professor Dr. David L. Altheide sagt, Medien vereinfachten die Realität so sehr, bis ein falsches Bild entstehe.Im Auge des ShitstormsOb Bankenrettung oder Euro-Krise: Politiker sind es gewohnt, sich im Auge des Sturms wiederzufinden. Neuerdings geht es nicht mehr um politische Inhalten, sondern öffentliche Äußerungen, die der Netzgemeinde nicht passen.Straftaten in 140 ZeichenEs kann jeden treffen: Vom Bundespräsidenten bis hin zu Otto Normalverbraucher. Über alle ergießen sich Kübel übelster Wortgespinste, losgetreten von einer amorphen Masse, die nur das gemeinsame Ziel im Überbietungswettbewerb eint. Willkommen im Shitstorm, dem Empörungsinstrument der Generation Twitter.
Die Piraten entern die deutschen Parlamente. Mit ihnen halten Forderungen nach bedingungsloser Transparenz (für den Staat) und permanenter Partizipation („Liquid Democracy“) Einzug in die Systeme politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung. Das Publikum ist zumeist fasziniert, der eine oder andere reagiert mit Grauen.

Was bedeutet diese Entwicklung, die durch die internetaffine Piratenpartei nicht einmal angestoßen, aber zumindest gefordert und allemal symbolisiert wird, für den (Fort-) Bestand der Demokratie im Internetzeitalter? Man spricht – in Anlehnung an das Web 2.0 – gerne von Demokratie 2.0 so, als ließe sich Demokratie versionieren wie eine Software. Zwar verlief auch die Entwicklung demokratischer Systeme in Entwicklungsstufen. Man kann sich unterdessen fragen, ob die „Version“ des demokratischen Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes mehr oder weniger ist als ein „Update“ ihrer Vorgängerversionen seit der Attischen Demokratie. Das mag hier dahinstehen.
Zweifellos nährt die aktuelle Diskussion um das politische Konzept der Piratenpartei mit ihren neuen, internetbasierten Instrumenten die Suche nach einem ersehnten Ausgleich viel beschworener Demokratiedefizite des überkommenen politischen Systems. So brachte es der Politikwissenschaftler Hans Vorländer in einem Beitrag für die F.A.Z. am 11. Juli 2011 („Spiel ohne Bürger“) auf den Punkt: „Die Legitimität der Demokratie ist in existentieller Weise gefährdet. Denn sie beruht nicht allein auf dem korrekten Vollzug von Entscheidungen. Eine demokratische Ordnung kann nur dann als legitim bezeichnet werden, wenn die Bürger den Eindruck und den Glauben haben, am demokratischen Leben hinreichend beteiligt zu sein, und gute und gerechte politische Entscheidungen getroffen werden. Daran fehlt es zurzeit.“
In aller Kurze lassen sich drei Attribute darstellen, die so etwas wie Demokratie 2.0 charakterisieren können: Resolutheit, Rationalität und Responsivität.
Politische Willensbildung und Einflussnahme durch die Bürger sind im Internetzeitalter resolut, nämlich entschlossen und zielstrebig. Wenn noch vor zehn Jahren eine zunehmende Politikverdrossenheit (die oftmals eher als Politikerverdrossenheit gemeint war) beklagt wurde, so kann man in letzter Zeit eher das Gegenteil konstatieren: ein zunehmendes Politikinteresse, und mehr: die Einmischung des „einfachen Bürgers“ in politische Diskussionen. Und das mit Erfolg. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Meinungsäußerung, erleichtert und getrieben durch seine „Plug and Play“-Funktionalität. Die entsprechenden Foren, Kommentarfunktionen der Online- Medien und vor allem Facebook und Twitter sind immer verfügbar und leicht bedienbar. Die Menschen werden dort angesprochen, wo sie sich heutzutage vielfach ohnehin aufhalten. Nicht in der Bürgerversammlung, sondern im Internet. Nicht auf der Suche nach Briefpapier, sondern mit Hilfe des Smartphones oder Laptops, zeit- und ortsunabhängig. Es sind aber nicht nur die erleichterten „Eingabemöglichkeiten“, sondern auch die Netzwerkeffekte der sozialen (besser: gesellschaftlichen) Medien wie Facebook, Xing oder Twitter, die zusätzliche Anreize bieten, das eigene Engagement und die persönliche Meinung im erweiterten Freundeskreis zu präsentieren und dort wiederum schnelle Resonanz zu erfahren.
Aber es geht weiter: Das, was etwa getwittert wird (und zuweilen zu einem Shitstorm ausartet), wird in Blogs aufgegriffen, dann in den Online-Portalen der etablierten Medien (wie spiegel.de oder zeit.de) verarbeitet, um nicht selten die Printmedien, den klassischen Rundfunk bis hin zu den Primetime- Nachrichten des Fernsehens zu erreichen. Das hat sich bei Themen wie der Plagiatsaffäre von zu Guttenberg oder den Affären um den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff gezeigt, betrifft aber auch politische Themen wie die Vorratsdatenspeicherung oder Stuttgart 21. Gerade die Erfahrung, dass Crowd Sourcing wie im Guttenplag Wiki oder medialer Druck auf den Bundespräsidenten sogar zu Rucktritten und damit verbundenen (personalen) Veränderungen des politischen Systems fuhren können, stärkt die Motivation des Einzelnen, sich einzubringen. Die genannten Beispiele belegen zugleich die Resolutheit der „demokratischen Waffe“ Internet.
Das Internet als Waffe? Wenn dieses Bild auch inhaltlich tragen soll, dann eher als Verteidigungs- und weniger als Angriffsinstrument. Zur Verteidigung der Volkssouveränität, die in der Parteiendemokratie zuweilen gelitten hat. Transparenz und Partizipation, denen das Internet zu neuer Realisierungschance verhilft, sind nämlich nicht Selbstzweck, sondern dienen einem übergeordneten Ziel, das gelegentlich übersehen wird: Qualität.
Beklagt werden nämlich nicht nur die Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfindung, sondern auch die Ergebnisse, in denen sich die Burger vielfach nicht wiederfinden. Demokratie 2.0 kann zu mehr Rationalität beitragen. Eine offene Politikgestaltung lässt falsche Sachverhalte, schlechte Argumente und verschleierte Partikularinteressen zu Tage treten, schafft eine realistische Tatsachenbasis und forciert Güter- und Interessenabwägungen. Das erhöht auch den Rechtfertigungsbedarf für politische Weichenstellungen, gleichzeitig schafft dies Akzeptanz und Legitimation. Ob die Instrumente hierzu „Liquid Democracy“ oder anders heißen, wird sich herausstellen. Auch diese Leitideen gehören auf den Prüfstand der Qualitätskontrolle. Der Fortschritt liegt bereits darin, Missstände, die allenfalls von zahnlosen Rechnungshöfen, dem Bund der Steuerzahler oder der auch nicht besser agierenden politischen Opposition angeprangert wurden, nunmehr ernsthaft, zielstrebig und nachhaltig beseitigen zu können.
Die digitale Revolution wird Opfer mit sich bringen: am ehesten aber unter denjenigen, denen ein intransparentes politisches System ungerechtfertigte Vorteile brachte. Rationalität ist ein Kennzeichen digitaler Systeme. Es taugt auch für politische Systeme, wenn man die Unvollkommenheit politischer Abwägungsprozesse gleichsam mit „einbaut“ und vermittelt. Es geht nicht um maximale Qualität als Illusion, sondern um die Option, Optimierungspotentiale überhaupt erst einmal zu nutzen.
Wenn das Internet also dem Bürger neue Macht verleiht (Resolutheit) und seine Anliegen im Sinne von Qualitätssteigerung legitim erscheinen (Rationalität), dann gibt es nur einen Weg, die Veränderungen, die das Internet für die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung mit sich bringt, im Rahmen der verfassungskonformen repräsentativen Demokratie zu verwirklichen: Responsivität. Der Bürger möchte mit seinen berechtigten Anliegen gehört und berücksichtigt werden. Und das muss keineswegs in blindem Populismus enden, wie das Beispiel ACTA zeigt. Der hiergegen vorgebrachte internationale Protest richtete sich – neben inhaltlichen Bedenken im gesellschaftlich brisantes Thema (die Produktpiraterie vor dem Hintergrund der Urheberrechtsreformdebatte) von den politisch Verantwortlichen behandelt wurde. „Hinterzimmerpolitik“ war da noch eines der harmlosen Attribute.
Das Gegenargument, wonach völkerrechtliche Verträge typischerweise nicht offen verhandelt werden, verfangt in diesem Zusammenhang nicht. Zwar mag es im internationalen Kontext durchaus Bedarf für diskrete Verhandlungen geben. Dies kann und sollte aber auch verständlich gemacht werden. Auch in Momenten der Intransparenz kann es also Transparenz geben: als Verständigung mit den Bürgern, welche Abwägungen und Überlegungen derlei Entscheidungen erst nötig machen. Das wurde bei ACTA versäumt. Die Aussetzung des Ratifizierungsverfahrens ist deshalb nur eine Notbremse. Der politische Prozess muss neu aufgerollt werden. Etwas anderes lasst der netzaffine „Wutbürger“ ohnehin nicht gelten. Er hat die Macht, das eine oder andere über die „digitalen Banden“ zu spielen, wie die zahlreichen „Treffer“ und „Versenkungen“
gezeigt haben.
Der Bürger hat aber auch kein Interesse daran, die Aufgabe der Politik und der gewählten Repräsentanten ganz zu übernehmen. Eine direkte Demokratie (nicht zu verwechseln mit einzelnen plebiszitären Elementen) wäre nicht nur verfassungswidrig, sondern auch ineffizient und letztlich unerwünscht. Es geht nicht um die Abschaffung, sondern die Verwirklichung der repräsentativen Demokratie unter neuen Vorzeichen. Diese hatte schon immer die Chance zur Responsivität, zur Rückkoppelung an das souveräne Volk, mit dem Ohr am Puls der Zeit und an den Herzen der Bürger.
Das Internet bietet aber erstmals die Instrumente, dies strukturiert, differenzierend und nachhaltig in die politischen Prozesse einzuspeisen. Daraus schöpfen Konzepte wie Open Government und Open Data oder die zahlreichen Beteiligungsplattformen ihre Überzeugungs- und Wirkkraft. Was früher schnell an mangelnden Ressourcen scheiterte, findet heute Widerstand allenfalls am politischen Willen mancher Entscheidungsträger, die sich im überkommenen System gemütlich eingerichtet haben. Weil der Druck auf solche Widerständler aber wachst (Resolutheit) und dem Qualitätsargument wenig entgegen gebracht werden kann (Rationalität), wird sich die Politik den Bürgern zuwenden müssen. Und das geschieht bereits.
So ist der einflussreichste (politische) Twitterer (gemessen an seinen Tweets, Retweets, Followern und Antworten) nicht etwa ein Blogger wie Sascha Lobo oder eine populäre Netzaktivistin wie Anke Domscheit- Berg oder die prominente und beliebte Piratin Marina Weisband, sondern der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Facebook wird – allen datenschutzrechtlichen Bedenken und börsennotierter Halbwertszeit zum Trotz – zur Informations-, Diskussions- und Werbeplattform des Staates (mit „Fanpages“ für Behörden und Verwaltungsprodukte), Youtube zum offenen, redaktionsfreien Bürgerkanal. Nicht jedem wird dies gefallen, und in der Tat bedarf die Frage der Trägermedien in der Hand amerikanischer Konzerne einer kritischen Betrachtung. Das Phänomen ist aber gesetzt, Demokratie 2.0 nicht mehr „rückführbar“.
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft werden lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Die Beteiligung der Bürger als „18. Sachverständiger“ der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft ist ein guter erster Schritt, ebenso der Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin. Im Übrigen genügt es vielleicht einfach, zuzuhören und hinzuschauen. Das Internet bietet der Politik ein Spiegelbild der Gesellschaft, das plastischer nicht sein könnte. So beginnt Gerald Viola seine Analyse zum Social Web als Stimmungsbarometer für den Öffentlichen Sektor, die am 31. Mai 2012 auf www. egovernment-computing.de veröffentlicht wurde, mit den Worten: „Es war noch nie so einfach wie heute, Einsichten zu Stimmungen und Meinungen der Bürger zu erhalten und mit ihnen in Kontakt zu treten – auch für den Öffentlichen Sektor. Angesichts der Social-Media-Aktivitäten eines Großteils der Bevölkerung und des Mitteilungsbedürfnisses der Burger musste die Öffentliche Verwaltung lediglich mitlesen.“ Dass solche „Social Media Analytics“ ihrerseits rechtlich diskussionswürdig sind, sei eingestanden.
Einstweilen wünsche ich eine gute Lektüre!
Grafik: Andreas Fachner