Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Demokratisches Donnerwetter – oder laues Lüftchen?
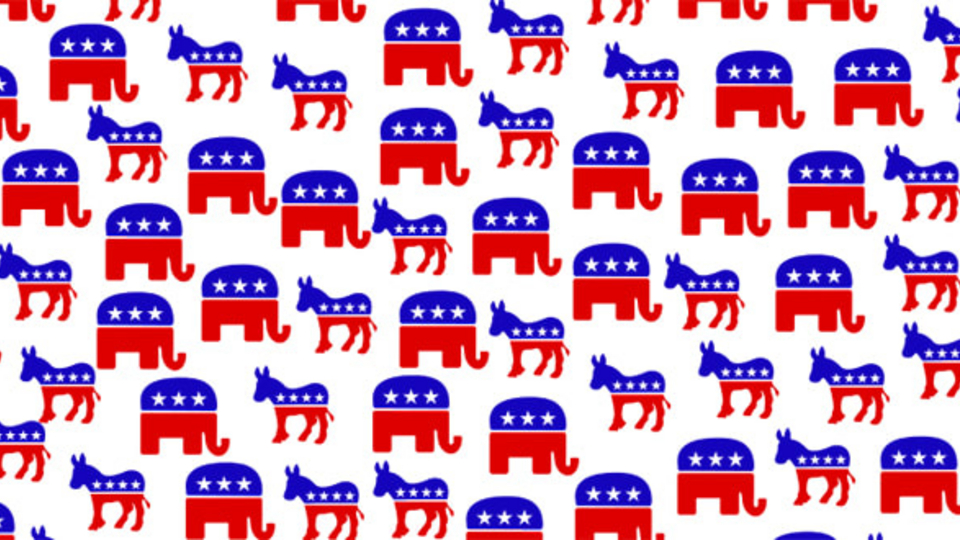

Prof. Dr. Martin Elff
Lehrstuhl für Politische Soziologie
- Zur PersonProf. Dr. Martin Elff
Der 1967 in Mannheim geborene Martin Elff studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie an der Universität Hamburg. Nach seinem Studienabschluss wechselte er an die Universität Mannheim, wo er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) und dann am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung tätig war. Nach seiner Promotion zum Thema „Politische Ideologien, soziale Gruppierungen und Wahlverhalten“ arbeitete er am selben Lehrstuhl als wissenschaftlicher Assistent, bevor ihn eine Lehrtätigkeit an die University of Essex (England) führte.
Zuletzt war Martin Elff Akademischer Rat am Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz. Dort habilitierte er 2013 über das Thema „Politischer Wettbewerb und Gesellschaft – Empirische und methodische Beiträge zur Analyse ihrer Wechselbeziehungen“ und befasste sich mit dem Wahlverhalten in Deutschland sowie Fragen der Bürgerkompetenz und der politischen Meinungsbildung. - Mehr ZU|DailyAuge um Auge – Zoll um ZollSojabohnen, Telefone, Motorräder – fast im Wochentakt werfen sich die USA und China neue Strafzölle um die Ohren. Was ist bloß los mit dem Welthandel? Diese Frage hat sich auch ZU-Alumnus Julian Bertmann gestellt – und in seiner Masterthesis beantwortet.Auf dem Gipfel der DemokratieDonald Trump, die AfD, rechte Demonstrationen. Naht das Ende der Demokratie? Tatsächlich spricht einiges dafür, dass der Gipfelpunkt der Demokratie erreicht ist. Was uns danach erwartet und welche Auswege noch bleiben, kommentiert ZU-Wissenschaftler Dietmar Schirmer.Ist die Realität noch zu retten?Fake News und gefühlte Wahrheiten – wo bleibt da noch Platz für die Realität? Höchste Zeit, über den Begriff nüchtern nachzudenken, fordert ZU-Professor Jan Söffner. Denn vielleicht müssen wir Realität neu verstehen lernen.
Die Kongresswahlen sind sogenannte Midterms – Wahlen, die in der Mitte der Amtszeit eines Präsidenten (oder hoffentlich zukünftig auch einer Präsidentin) stattfinden. Bei den Senatsmitgliedern ist das anders: Die Amtszeit der Senatsmitglieder beträgt sechs Jahre, und alle zwei Jahre erfolgt die Neubesetzung von einem Drittel des Senats – daher werden eben nicht alle Senatoren zur gleichen Zeit neu gewählt. Während das Ergebnis für das Repräsentantenhaus – von den Wirkungen des Mehrheitswahlrechts abgesehen – die aktuelle politische Stimmung im ganzen Land wiedergeben kann, gilt das also weniger für das Ergebnis für den Senat. Hinzu kommt, dass im Senat die US-Staaten und nicht die Bevölkerung der USA vertreten sind. Die Repräsentation der Bewohner in den einzelnen Staaten steht daher in einem deutlichen Missverhältnis: Denn sowohl etwa 40 Millionen Kalifornier als auch 600 Tausend Einwohner von Wyoming werden von jeweils zwei Senatsmitgliedern vertreten.
Dies benachteiligt vor allem die Demokraten, die in den bevölkerungsreichen und urbanen Staaten Mehrheiten haben, während die Republikaner vor allem in den bevölkerungsarmen und ländlichen Staaten des amerikanischen „Heartland“ stark sind. Ihre neuen Senatssitze gewannen die Republikaner auch ausschließlich in den ländlichen Staaten Indiana, Missouri und North Dakota. Und während die Mehrheit der neu zu besetzenden Senatssitze an die Republikaner ging, hatte eine Mehrheit von 57 Prozent der Wähler dabei Kandidaten der Demokraten gewählt. Damit spiegelt das Ergebnis der Senatswahlen die Stimmenverteilung in der Bevölkerung noch schlechter wider als das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2016. Insofern bleiben die USA ein System der fabrizierten Mehrheiten.

Die diesjährigen Midterms beinhalten eine Reihe von „Historic Firsts“: die ersten Vertreterinnen der Native Americans (der amerikanischen Ureinwohner) im Repräsentantenhaus und der erste offen homosexuelle Kandidat, der ein Gouverneursamt gewonnen hat – neben Repräsentantenhaus und einem Drittel des Senats wurden in einigen US-Staaten auch Gouverneure und Legislativen gewählt.
Dennoch können die Demokraten ihr Ergebnis im Repräsentantenhaus nicht uneingeschränkt als „Blue Wave“ feiern: Zwar haben sie die Mehrheit der abgegebenen Wahlstimmen im Vergleich zur Präsidentschaftswahl von 2016 noch etwas ausbauen können (von einer 48-prozentigen relativen Mehrheit auf eine absolute Mehrheit von 51 Prozent), sie konnten aber kaum in die eher ländlichen Distrikte expandieren, die weiterhin von den Republikanern dominiert werden. Das Wahlergebnis offenbart in dieser Hinsicht keine großen Überraschungen, stattdessen setzt sich das schon bekannte Muster der Polarisierung zwischen urbanem und ländlichem Amerika fort. Was aber den Demokraten dennoch einige Hoffnung zu geben vermag: Weder Gerrymandering – das manipulative Zuschneiden von Wahlbezirken – noch Voter Suppression – also Maßnahmen, Bevölkerungsgruppen von der Wahl auszuschließen – haben verhindern können, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus eine Mehrheit der Sitze errangen.
Zwar hat Donald Trump die republikanische Senatsmehrheit nach der Wahl als seinen Erfolg in Anspruch genommen, aber eigentlich sollte ihm das Ergebnis der Midterms im Senat eher Sorgen machen. Seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren hatte er zur Überraschung Vieler vor allem deshalb errungen, weil er die „Rust Belt“-Staaten Iowa, Michigan, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin den Demokraten abgewinnen konnte. Bei der Wahl in diesem November aber gingen die Senatssitze von vier dieser Staaten an die Demokraten, und in Iowa konnten sie einen weiteren Sitz für das Repräsentantenhaus gewinnen. Auch ist das Electoral College nicht ganz so disproportional aufgebaut wie der Senat: Die Anzahl der auf einen Staat entfallenden Electors steigt mit der Bevölkerungszahl, anders als die Anzahl der Senatssitze.
Zwar konnten Trump und das republikanische Lager das ländliche Amerika als elektorales Bollwerk behaupten, aber ob sich damit weiterhin USA-weite Mehrheiten gewinnen lassen, ist fraglich, insbesondere dann, wenn irgendwann doch die Folgen der von Trump angezettelten Handelskonflikte für die Landwirtschaft spürbar werden.
Titelbild:
| GDJ / Pixabay.com (CC0 Public Domain) | Link
Bild im Text:
| Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America - Donald Trump (CC BY-SA 2.0) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Martin Elff
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm



