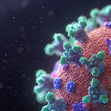Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.
ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.
Abgrund statt Solidarität


Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Gastprofessur für Literaturwissenschaften
- Zur PersonProf. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Der gebürtige Würzburger Professor Dr. Hans Ulrich Gumbrecht ist ständiger Gastprofessor für Literaturwissenschaften an die Zeppelin Universität. Er studierte Romanistik, Germanistik, Philosophie und Soziologie in München, Regensburg, Salamanca, Pavia und Konstanz. Seit 1989 bekleidete er verschiedene Professuren für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften der Stanford University. Einem breiteren Publikum ist er bereits seit Ende der 1980er-Jahre durch zahlreiche Beiträge im Feuilleton vor allem der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Neuen Zürcher Zeitung sowie durch seine Essays bekannt. Darin befasst er sich immer wieder auch mit der Rolle des Sports. Gumbrecht ist bekennender Fußballfan und Anhänger von Borussia Dortmund.
- Mehr ZU|DailySchuldenscheck oder Solidarität?Deutschland sträubt sich vehement gegen gemeinsame Anleihen zum Kampf gegen die Folgen der Pandemie. ZU-Gastprofessor Marcel Tyrell hat einen entscheidenen Hinweis an die Spitzenpolitiker, die sich gegen die Corona-Bonds wehren.Die neue ZeitrechnungLange glaubten die Menschen, die Gegenwart würde sich dauerhaft fortsetzen. Nun hat das Coronavirus die Fragilität des Jetzt offenbart. Mit der Pandemie bricht eine neue Zeitrechnung an, meint ZU-Professor Jan Söffner.Wie wir die Pandemie besiegenVier Experten der Zeppelin Universität haben mit wissenschaftlichen Befunden einen Leitfaden erstellt, um die Krise zu bewältigen. Ein Faktor ist dabei lebensnotwendig.
Mit entschlossener Selbstzufriedenheit ist dieser Tage immer wieder von „Solidarität“ die Rede gewesen – und erstaunlich wenig vom Abgrund, den wir vermeiden oder vielleicht auch überqueren müssen. Es hat wohl damit zu tun, dass niemand wirklich weiß, wie tief der Abgrund ist und wie es auf der anderen Seite aussehen könnte. Was Solidarität angeht, so stellt sich eher die Frage, ob wir uns tatsächlich in einer Situation befinden, auf die der Begriff passt. Er setzt ja den freien und deshalb auch immer großzügigen Entschluss zu einem Verzicht voraus, um anderen Leuten in eine Lage zu verhelfen, die der eigenen ähnlicher ist, als es ohne diesen Verzicht der Fall wäre. Anders gesagt: Ohne die Voraussetzung einer deutlichen Ungleichheit, die reduziert – nicht unbedingt ganz aufgehoben – werden soll, kann es keine Solidarität geben.
Dass diese Prämisse der Ungleichheit keinesfalls zu unserer neuen, fast global gewordenen Szene gehört, zeigt ein Blick auf das „Social Distancing“ als ihr Grundelement. Jede Person, die mir heute in realer Präsenz auf der Straße, in einem Park oder möglicherweise noch bei der Arbeit begegnet, verkörpert eine Ansteckungsgefahr für mich, so wie ich eine Ansteckungsgefahr für sie bin. Niemand kann also nur großzügig sein mit seinem Distanzprotokoll, ohne davon selbst zu profitieren, so wie jeder, der die Abstandsregel vergisst, auch sich selbst in Gefahr bringt. Alle sind gleich vor dem Coronavirus.
Oder erwächst doch eine Ungleichheit aus den altersspezifisch verschiedenen Statistiken der Ansteckungswahrscheinlichkeit – und des auf eine Ansteckung möglicherweise folgenden tödlichen Verlaufs? Müssen wir alten Leute nicht den Jungen dafür besonders dankbar sein, dass sie Abstand zu uns halten? Also doch ein Akt der Solidarität? Ich glaube nein, weil die Statistiken widersprüchlich und das Wissen über die Mechanismen der Ansteckung vage genug sind, um uns alle unter der Voraussetzung des „schlimmsten Falls“ (des „worst case scenario“) zu vereinigen. Alle tun das Maximum, um dem Virus zu entkommen, schon Gelassenheit gilt als Gefahrenquelle. Und angesichts dieser Gleichheitsvoraussetzung als seinem Auslöser hat unser Verhalten keine warm rührenden Solidaritätsworte verdient – oder nötig.

Doch selbst wer mit Giorgio Agamben erstaunt – und sogar besorgt – auf die geschlossene Bereitschaft reagiert, trotz täglich oszillierender Informationslagen die anscheinend vernünftigen Konsequenzen zu ziehen, wird zugeben, dass sich ein derzeit noch mit Schweigen bedecktes Bewusstsein ausdehnt, am Rand des Abgrunds zu stehen. Möglicherweise ist dieser „Abgrund“ für die meisten Zeitgenossen bloß eine ungeheure Intensivierung des Gefühls von unserer existentiellen Grundsituation als „Leben zum Tode“ (wie wir seit 1927 mit Martin Heidegger sagen können), eine ungeheure Intensivierung des Wissens um die Unvermeidlichkeit des eigenen Tods, eine Intensivierung, der gar keine nachweisbar drastische Erhöhung des individuellen Todesrisikos entspricht, nicht einmal für einen Zweiundsiebzigjährigen wie mich.
Es handelt sich um einen Abgrund, für dessen Ernst wir keine verlässlichen Zahlen und schon gar keine Worte haben. Gerade deshalb – und nicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte – haben viele Zeitgenossen mit Impulsen der Feier und des Exzesses geantwortet, mit „Tänzen am Abgrund“. Natürlich beziehe ich mich vor allem auf die sogenannten „Corona-Partys“, von denen die Medien vor wenigen Wochen täglich im Brustton der Empörung berichteten, während sie nun – beinahe leider – zum Stillstand gekommen sind. Beinahe leider? Offenbar steht außer Frage, dass solche Feste die Pandemiegefahr auch für Leute erhöhen, die nie an ihnen teilnehmen wollten – und insofern muss man ihr Verschwinden begrüßen. Andererseits mag in ihnen eine Bejahung des Lebens spürbar geworden sein, die uns angesichts der teils auferlegten, teils gewählten kollektiven Vorsicht gerade aus den Händen rinnt.
Auf mindestens drei verschiedene Typen von Ereignissen bezogen sich Nachrichten mit dem Wort „Corona-Partys“. Saisongebunden – und vor allem durch Fotos der Strände von Florida illustriert – auf die ausgelassenen Feste, mit denen amerikanische College-Studenten ihre Frühlingsferien einläuten. Diese Feste eben „wollten sie sich vom Virus nicht verderben lassen“, las man immer wieder zu einer Zeit, als auch die vernünftigsten Erwachsenen noch zögerten, ihre schon gebuchten Flüge zu stornieren. Bis in die Gegenwart und sicher die Zukunft reichen dann hinter den verbarrikadierten Türen privater Clubs und Wohnungen die Treffen von Menschen, zu deren Alkoholsucht das Bedürfnis gehört, sich im Kollektiv zu betrinken. Eine Pathologie, die unter Corona-Bedingungen sichtbarer wird als sonst, ohne eigentlich mit der Symptomatologie unserer Krise – und ihrem existentiell spezifischen Abgrund – zu tun zu haben. Und schließlich die Feste von jungen Leuten, kaum je über Zwanzig, an Seeufern, in Parks oder Burgruinen, um europäische oder nordamerikanische Berichte zu zitieren, Feste im Offenen, die von der Krise ausgelöst waren statt von kurzfristig abgesagten Reiseplänen oder langfristigen Suchtproblemen.
Ohne sie in greisenhafter Nostalgie verklären zu wollen, fällt auf, dass sich Partys dieser Art – so „wild“ sie gewesen sein mögen und ganz anders als die verbarrikadierten Gelage – in der Konfrontation mit Polizeistreifen meist ohne Problem oder Widerrede auflösten. Geradezu friedfertig und ganz im Gegensatz zu den wütenden elektronischen Kommentaren, die sie mit Verachtung und Kriminalitätsvorwürfen überhäuften. Solche Feste waren Rituale am Rand des Abgrunds, Feste im Offenen und im Angesicht des eigenen Todes, Feste eines Erlebens, vor dem wir sonst, wie Heidegger zurecht betonte, möglichst die Augen verschließen. Und solche Feste hat es schon immer gegeben. Plutarch, ein Meisterbiograf des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, beschreibt, wie Kleopatra und Mark Anton nach der Seeschlacht von Actium, die sie gegen den späteren Kaiser Augustus verloren hatten, ohne politische Hoffnungen und Hoffnungen auf ein für sie ehrbares Überleben blieben – und sich gerade deshalb „in Freude an ausgiebigen Mälern und Trinkgelagen und Orgien des Beschenkens ergingen“, um schließlich „ihre berühmte ,Gesellschaft der unnachahmlichen Lebensfreunde‘ durch ,eine Gesellschaft der Partner im Tod‘ zu ersetzen, die nicht weniger exzessiv und exzentrisch war.“
Auch die verstörendste Szene des Films „Der Untergang“ über die letzten Tage im Führerbunker mit dem großen Bruno Ganz als Hitler hat einen dokumentierten Hintergrund. Dort entschließt sich Eva Braun, Hitlers sonst nur aufgrund ihrer banalen Normalität bemerkenswerte Lebensgefährtin, den 20. April 1945 als Geburtstag des amtierenden Reichskanzlers mit einem frenetischen Tanzfest zu Ende zu bringen – und zwar außerhalb des Bunkers in ihrer Privatwohnung, die den Bomben und Geschützen der vor Berlin stehenden Roten Armee ausgesetzt war. Um eine nur scheinbar naheliegende ausschließliche Assoziation solcher Ereignisse mit Protagonisten der politischen Bühne oder mit den schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu blockieren, ist es wichtig zu erwähnen, dass exzessive Feste im Angesicht des gewissen eigenen Todes auch unter den ersten von AIDS bedrohten und infizierten Gruppen während der frühen 80er-Jahre eine zentrale Rolle spielten.
Doch wie kann man den Zusammenhang zwischen der – wenigstens in einer säkularen Existenz – unvermeidlichen Angst vor dem eigenen Tod (als Ende des eigenen Bewusstseins und mithin als „Nichts“) und den Impulsen zu einem Verhalten erklären, welches das Eintreten des Todes nur wahrscheinlicher macht? Auf diese Frage gibt es – je nach theoretischen Vororientierungen und individuellen Lebensumständen – fast beliebig viele Antworten. Die am wenigstens interessante und wohl am häufigsten zutreffende unter ihnen nennt „Verdrängung“ als einen kollektiv heraufbeschworenen Rauschzustand, aus dem man mit verstärkten Depressionssymptomen als Katzenjammer aufwacht. Plausibel ist auch das – halb kalkulierte, halb vorbewusst akzeptierte – Risiko, die Zeit des Wartens auf den sicheren Tod abzukürzen, ohne sich aktiv das Leben zu nehmen (dies könnte die Motivation für Eva Braun gewesen sein, ihr am 20. April 1945 im bombenbedrohten eigenen Apartment zu feiern).

Zur Corona-Situation mit ihrem singulären Grad an Unsicherheit über den eigenen Infektionsstatus und möglichen Krankheitsverlauf (zum ersten Mal in den meisten westlichen Ländern darf man ja nicht einmal damit rechnen, dass die medizinisch optimale Behandlung als Möglichkeit zugänglich sein wird), zur Corona-Situation passt auch eine Motivation der Intensitätssteigerung. Wenn wir – frei nach Gilles Deleuze – Intensität als eine Bewegung außerhalb unserer selbst auffassen, die sich zwischen einem Ausgang in absoluter Beliebigkeit („nichts ist undenkbar“) und einem Endpunkt vollkommener Bestimmtheit („schwarzen Löchern“) vollzieht, dann können gerade Momente der physischen Nähe in erotischer und narkotischer Ekstase jene Prozesse auslösen, die von nicht auszuhaltender Ungewissheit hin zum Tod als letzter, schwarzer Gewissheit führen.
Vor allem – und das ist ihre denkbar elementarste Erklärung – haben Feste im Angesicht des Todes immer das bejaht, was auf dem Spiel stand und verloren zu gehen drohte: die Fülle des sinnlichen wie des sinnhaften Lebens und des Lebens in der Zuwendung auf die körperliche Präsenz anderer Menschen. Die abstrakte Feier der vermeintlichen Solidarität in unserem zur Norm und Routine werdenden Distanzverhalten hingegen enthält, zumal wenn sich die gegenwärtige Situation nicht rasch verändern sollte, die Gefahr einer Gewöhnung ans Über-Leben – und das gilt auch für gutgemeinte Phrasen wie das Lob der sozialen Entschleunigung oder der Familienabende über unterhaltsamen Brettspielen. Diese Gefahr, Über-Leben mit Leben zu verwechseln, ist eingefangen in die existentiell neue – ebenfalls abstrakte – Situation, kollektiv im Angesicht des je eigenen Todes zu leben.
Solange Partys verboten bleiben, ist es also wichtig, sich wenigstens an ihre Konkretheit zu erinnern – statt sie im Namen von Distanz und Hygiene zu verachten.
Dieser Artikel ist am 19. April unter dem Titel „Das Leben am Abgrund: Was uns die Corona-Partys über unser eigenes Verhältnis zum Leben (und zum Tod) verraten“ in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen.
Titelbild:
| Amy Shamblen / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Bilder im Text:
| Juan Rojas / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
| Florian Wehde / Unsplash.com (CC0 Public Domain) | Link
Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht
Redaktionelle Umsetzung: Florian Gehm